Aktuelle Projekte im Forschungsschwerpunkt Forst- und Holzwirtschaft

Mittelgeber/Projektträger:
Gefördert wird das Vorhaben durch das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) und die Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V. (FNR)
Laufzeit:
01.07.2024 / 2,5 Jahre , 30 Monate
Projektverantwortung:
Leitung Verbundprojekt & Teilvorhaben 1: Entwicklung der DIN SPEC 35808 „Wuchshülle-Wald“ –Koordination und Finalisierung Normdokument Hochschule für Forstwirtschaft Rottenburg (HFR) (Projektleitung, Koordination) Prof. Dr. habil. Sebastian Hein
Projektpartner:
Hohenstein Innovation gGmbH
Projektmitarbeiter/innen:
Dr.-Ing. Silke Feifel, B.Sc. Eileen Ottilige
Beschreibung:
Mit der Entwicklung einer DIN SPEC 35808 für unter Waldbedingungen biologisch abbaubare Wuchshüllen aus nachwachsenden Rohstoffen (inkl. Anforderungen und Prüfverfahren) wird eine klare Orientierung für die forstliche Praxis und produzierende Marktteilnehmer geschaffen und formuliert - mit dem Definitionsziel welche Wuchshüllen aufgrund der Materialeigenschaften sowie einer auszuschließenden Mikroplastikgefahr aus umweltökologischer Sicht keinen Rückbau erforderlich machen. Dazu werden Vorarbeiten aus dem Projekt TheForestCleanup verwendet, um DIN-konforme Prüfverfahren a) zur vollständigen biologischen Abbaubarkeit (entsprechend Test III/ d.h. Erdeinlagerung aus DIN-Entwurf, AP 1-2) etablieren, zu validieren und zu finalisieren (AP3) und b) zur vollständigen Biobasiertheit und Bewitterung (hier Etablierung und Validierung bereits erfolgt) zu finalisieren (AP3). Dies geschieht entsprechend dem DIN-Normierungsprozess mit Konsensfindung, Formulierung und Publikation. Dabei werden ausgewählte Material- und Wuchshüllentypen sowie Referenzmaterialien den Prüfverfahren (inkl. Ökotoxizität) unterzogen und mit statistischen Forecast-Methoden insbesondere hinsichtlich der Vollständigkeit des biologischen Abbaus in waldnahen Bedingungen überprüft. Der Transfer und Verwertung der Projektergebnisse in/ durch die Sphäre der fachliche Entscheider wird u.a. durch die Integration von Konsortialpartnern vor allem aus Waldbewirtschaftung in DE und auch dem produzierenden Gewerbe sichergestellt. Diese Erarbeitungen erfolgen im Sinne einer Plastikreduktionsstrategie Wald sowie für einen erfolgreichen Innovations- und Normierungsprozess, der einerseits Umsatz und Beschäftigung ermöglicht vor allem aber dem besseren Schutz des Ökosystems Wald und seiner nachhaltigeren Bewirtschaftung dient.
Link:

Fördermittelgeber:
Eva Mayr-Stihl Stiftung
Laufzeit:
01.04.2025-30.09.2025
Projektverantwortung:
Prof. Dr. Monika Bachinger
Projektpartner:
Universität Bayreuth
Projektmitarbeiter/innen:
M. A. Franziska Schlemmer, B. Sc. Stefanie Irowetz
Beschreibung:
Das vorliegende Projekt zielt auf Beiträge zur Lösung von Nutzerkonflikten durch Mountainbiken im Wald. Durch die Erfassung von bestehenden Forschungsarbeiten und die Vernetzung von Forschenden und Vertretern der Praxis sollen die Voraussetzungen dafür geschaffen werden, dass Nutzungskonflikte genauer verstanden und verlässliche Lösungsmöglichkeiten skizziert werden können. Es kommt ein Methodenmix zum Einsatz, der eine quantitative Befragung, die soziale Netzwerkanalyse und einen Workshop mit Experten umfasst. Inhaltlich leistet das Projekt die Identifikation von wissensschaffenden Akteuren im Bereich von Wald und Mountainbiken, die Befragung dieser Akteure zu bearbeiteten Themen, deren Finanzierung und Vernetzung. Vor diesem Hintergrund werden Kooperationspotenziale eruiert und praxisrelevante Forschungslücken identifiziert. Beide werden publiziert, um Forschenden, Praxisvertreterinnen und Fördermittelgebern Orientierung und Anschluss zu ermöglichen.

FÖRDERGEBER:
Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF); DATIpilot – Fördern & Lernen für Innovation und Transfer
PROJEKTLAUFZEIT:
01.01.2025 – 31.12.2028
PROJEKTVERANTWORTUNG:
Prof. Dr. Dirk Wolff
PROJEKTMITARBEITERINNEN:
Dipl. Ing. Annette Müller-Birkenmeier
M.Sc. Margarethe Hergott

PROJEKTPARTNER:
Stadt Reutlingen - Feuerwehr
ANSPRECHPARTNER/IN:

Prof. Dr. Dirk Wolff
Professur für Waldarbeit und Forsttechnik
T. +49 7472/951-242
F. +49 7472/951-200
M.dirk.wolff@hs-rottenburg.deRaum: 125, Südflügel
Sprechzeiten
nach Vereinbarung

Dipl.-Ing. (FH) Annette Müller-Birkenmeier
Projektmitarbeiterin
Kontakt:
vegetationsbrand@hs-rottenburg.de
BESCHREIBUNG:
Bisher spielen Waldbrände in Deutschland noch keine so große Rolle wie in manch anderen Ländern, angesichts des Klimawandels gewinnt dieses Thema aber auch hierzulande an Bedeutung und die Anzahl der Waldbrände und waldbrandbegünstigender Witterungsverhältnisse nimmt tendenziell immer weiter zu. Um die erforderliche Kompetenz in der Prävention und Bekämpfung von Waldbränden aufzubauen, müssen deswegen sowohl die Mitarbeiter*innen aus der Forstwirtschaft als auch der Feuerwehren entsprechend sensibilisiert und ausgebildet werden. Für eine effektive Zusammenarbeit im Ernstfall müssen zudem geeignete Organisations- und Kommunikationsstrukturen etabliert und Abläufe gemeinsam geübt werden.
Ziel des Vorhabens ForestFireFighting TransferLaboratory ist die Entwicklung und Etablierung eines landesweit zentralen, bundesweit aktiven und international gut vernetzten Kompetenzzentrums zur Waldbrandprävention und Waldbrandbekämpfung, um den Innovations- und Wissenstransfer zwischen Wehr und Wald zu verbessern und die Effizienz bei Waldbrandeinsätzen zu steigern.
Ein zentrales Managementteam (HFR und Feuerwehr Reutlingen) wird tragfähige Kooperationen aufbauen und weitere Teilprojekte fördern und koordinieren (TP1: Koordination, Sensibilisierung Forst).
Für relevante, förderwürdige Teilprojekte, in denen konkrete Fragestellungen bearbeitet und technische oder organisatorische Lösungen entwickelt werden, die die Prävention und die Arbeit gegen Waldbrände in Deutschland erleichtern und effektiver machen könnten und möglichst schnell für alle verfügbar sind, stehen innerhalb der vierjährigen Projektlaufzeit mehr als drei Millionen Euro der Gesamtfördersumme bereit.
Das Vorhaben wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert, begleitet wird es durch den Projektträger Jülich (PtJ). „FFFLab“ ist eines von 20 Vorhaben, die im Rahmen der neuen Förderrichtlinie DATIpilot gefördert werden, um den Transfer von Wissen aus der Forschung in die Anwendung voranzutreiben, neue Lösungsansätze für gesellschaftliche Herausforderungen zu generieren und wichtige Erkenntnisse für die Innovations- und Transferförderung und den Aufbau der Deutschen Agentur für Transfer und Innovation (DATI) zu gewinnen.
Teilaspekt A - „Holzbereitstellungsprozessoptimierung in der Supply Chain“

Mittelgeber/Projektträger:
Dieses Projekt wird unter dem Dach der Waldstrategie Baden-Württemberg umgesetzt und durch das Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg gefördert. Die Förderung wird aus Landesmitteln finanziert, die der Landtag von Baden-Württemberg beschlossen hat.
Laufzeit:
1. Januar 2024 - 31. Dezember 2025
Projektverantwortung:
Prof. Dr. Artur Petkau
Projektpartner:
Universität Freiburg, Professur für Forstökonomie und Forstplanung
unique landuse GmbH
Projektmitarbeiter/innen:
M.Sc. Luca Kiener
Beschreibung:
Die Hochschule für Forstwirtschaft Rottenburg befasst sich im Teilaspekt A des Forschungsprojekts „Stärkung der Kooperationsstrukturen im Privatwald zur Begegnung der Herausforderungen des Klimawandels“ (PRIMA-Wald), mit Holzbereitstellungsprozessoptimierungen in der Supply Chain vor dem Hintergrund der Spannungsfelder des Klimawandels und sich verändernder gesellschaftlicher Ansprüche an Wälder und die Waldbewirtschaftung.
Das Modellgebiet „hinteres Renchtal“ im mittleren Schwarzwald umfasst die Gemeindegebiete Oppenau und Bad-Peterstal Griesbach, ist besonders von Borkenkäferkalamitätsschäden betroffen und zugleich von großen bäuerlichen Privatwaldflächen sowie Waldbesitzgemengelagen mit Kommunalwald und Landeswald der ForstBW und des Nationalparks Schwarzwald geprägt. Das Projekt dient der Er- und Bearbeitung von konkreten Handlungsempfehlungen auf Basis der im Koalitionsvertrag angedachten Privatwaldkonzeption für Privatwaldbesitzende, Zusammenschlüsse, aber auch staatlichen und privaten Beratungs- und Betreuungsorganisationen und in gemeinsame Prozesse integrierte Dienstleistungsunternehmen und Kunden.
Das Projekt zielt darauf ab „Best-Practice-Modelle“ zu entwickeln, die der Bewältigung der Herausforderungen des Klimawandels dienen; dies auch speziell in direkter Nachbarschaft zu einem Großschutzgebiet. Gegenstand der Betrachtungen sind die Prozessketten der privaten, staatlichen und kommunalen Waldbewirtschafter im Modellgebiet sowie die der Akteure innerhalb dieser Prozessketten, wie beispielweise forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse und Holzvermarktungsorganisationen.
Die vorgenannten Akteure und Partner werden im Zuge des Projekts bei aktuellen Herausforderungen innerhalb der Kalamitätsholzbereitstellung und in ihrer strategischen Weiterentwicklung konzeptionell unterstütz. Der Schwerpunkt liegt auf den Ablauforganisationen und den Prozessen vom Erkennen des Borkenkäferbefalls, über die Hiebsplanung bis hin zum Transport zur Weiterverarbeitung des Kalamitätsholzes mit allen Schnittstellen und parallelen Teilprozessen. In diesem Kontext liegt der Fokus auch bislang ungenutzten Synergieeffekte zwischen den Akteuren und deren Prozessketten.
Im Rahmen von Workshops und Expertengesprächen werden konkrete Handlungsempfehlungen zur Verbesserung des Borkenkäfermonitorings und der Kalamitätsholzbereitstellung für und mit den Projektpartnern erarbeitet sowie deren Umsetzungen – wo möglich – wissenschaftlich begleitet.
Zugleich wird die Bedeutung der aktuellen und potentiell möglichen forstlichen Förderung für diese Prozesse beleuchtet. Fördermaßnahmen werden auf ihre Wirksamkeit in unterschiedlichen Szenarien untersucht und priorisiert. Hierbei wird die räumliche Nähe zum Nationalpark Schwarzwald berücksichtigt und in Zusammenarbeit mit Praxispartnern, dem Ministerium für ländlichen Raum, dem Umweltministerium und dem Regierungspräsidium Freiburg, auf Basis von Kosten- und Nutzenanalysen sowie Vergleichskalkulationen Anregungen zur Weiterentwicklung der Fördermaßnahmen, inkl. der Förderhöhen entwickelt und ggf. implementiert.

Mittelgeber/Projektträger:
Das Projekt wird unter dem Dach der Waldstrategie Baden-Württemberg umgesetzt und durch das Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg gefördert. Die Förderung wird aus Landesmitteln finanziert, die der Landtag von Baden-Württemberg beschlossen hat.
Laufzeit:
01.07.2024 – 30.06.2026
Projektverantwortung:
Prof. Dr. Christoph Schurr
Projektpartner:
Universität Freiburg, Professur für Forst- und Umweltpolitik
unique land use GmbH
Projektmitarbeiter/innen:
M.A. Elias Hechinger
Beschreibung:
Unter dem Einfluss von Agrarstrukturwandel und Urbanisierung der Gesellschaft schreitet die Fragmentierung des Kleinprivatwaldes voran. Daraus hat sich eine große Bandbreite von Bewirtschaftungsformen und –intensitäten sowie Eigentümerzielen und damit eine Eigentumsstreuung über viele gesellschaftliche Gruppen herausgebildet. Aus eigentumspolitischer Perspektive kann diese Entwicklung positiv gesehen werden. Vor dem Hintergrund der zunehmenden gesellschaftlichen Ansprüche an den Wald und dem zunehmenden Anpassungsdruck durch Klimarisiken stellt sie die Akteure der Forstpolitik aber vor große Herausforderungen.
Strukturelle Hemmnisse im sehr kleinteiligen Waldbesitz beeinträchtigen die Effizienz und die Umsetzbarkeit eines Waldmanagements im Privatwald. Eine zielgruppenangepasste Kommunikation, die die Motive der Waldbesitzenden berücksichtigt, gemeinschaftliche Bewirtschaftung kleinstrukturierten Waldbesitzes und neue Kooperationsformen bieten vielversprechende Lösungen, um diese Probleme zu überwinden und somit eine nachhaltige Waldbewirtschaftung sicherstellen zu können.
Ziele des hier beschriebenen Forschungsprojekts sind, Interessen und Bedürfnisse von Waldbesitzenden zu erkunden, die durch das bestehende Instrumentarium der Kleinprivatwaldpolitik bisher wenig angesprochen werden und Kooperationsformen (weiter) zu entwickeln, die geeignet sind, diese Waldbesitzenden zu beraten und ihnen Handlungsfähigkeit zu geben.
Die spezifische Zielsetzung im Arbeitspaket der Hochschule für Forstwirtschaft Rottenburg besteht darin, in mindestens einem noch auszuwählenden Pilotort bzw. einer Pilotregion in Baden-Württemberg mit lokalen/ regionalen Akteuren, die über Erfahrung im Bereich kommunale Entwicklung, Genossenschaftswesen und Gemeinwohlökonomie verfügen, eine kooperative Organisation zu initiieren. Diese soll Modelle regionalen Engagements für Wald und Landschaft entwickeln. Das Angebot zur Beteiligung und zum Engagement richtet sich an Waldbesitzende und Nicht-Waldbesitzende, zentral ist somit die sektorenübergreifende Einbindung diverser Akteure u.a. aus dem zivilgesellschaftlichen Bereich.
Mittelgeber:
Gefördert wird das Vorhaben durch die Klimaschutzstiftung Baden-Württemberg im Rahmen des Programms „Zirkuläres Bauen: Klimaschutz durch Kreislaufwirtschaft“.
Laufzeit:
01.07.2024 – 30.06.2026
Projektverantwortung:
Prof. Dr. Marcus Müller
Projektpartner:
Zimmerei- und Schreinereibetrieb Bühler Bau aus Reutlingen
Projektmitarbeiter/innen:
M.Sc. Melissa Christ
Beschreibung:
Zum 01.07.2024 startete das Projekt StoGBau „Stoffliche Verwendung von Gebrauchtholz als Bauprodukt“ unter der Leitung von Prof. Dr. Marcus Müller. In dem geplanten Forschungsvorhaben soll die stoffliche Wiederverwendung von Gebrauchthölzern nach deren Rückbau untersucht werden. Ebenso zu ermitteln sind die technische Machbarkeit und die Wirtschaftlichkeit.
Die steigende Häufigkeit von Schadereignissen und der parallele Export des Rohstoffes Holz in die USA und nach China haben in den letzten Jahren zu einem relevanten Rohstoffmangel geführt. Daraus resultierend haben sich die Preise und Verfügbarkeit verändert, was unmittelbar eine Änderung der Angebotslage mit sich gezogen hat. Durch die stoffliche Nutzung von Altholz (Kategorie A1 bis A3) im Baubereich ist es möglich, eine Angebotserhöhung und somit eine Entspannung der Angebotssituation zu schaffen. Bisher ist eine (Wieder-)Nutzung von Altholz aus dem Rückbau aufgrund der gesetzlichen Regelungen nicht möglich. Durch eine anstehende Novellierung der Altholzverordnung soll diese Opportunität geschaffen werden.
Aus Rückbauten anfallendes Altholz soll aufbereitet werden, um es in zukünftigen Bauprojekten als Bauprodukt verwenden zu können. In einem ersten Schritt werden die verfügbaren Sortimente bewertet und geeignete Rohstoffe ausgewählt. Damit der Rohstoff den Anforderungen der Wiederverwendung genügt, sind z.B. eine Reinigung der Oberfläche und eine Erkennung von Holzschutzmitteln sowie von Metallteilen notwendig. Anschließend erfolgt eine Sortierung zu geeigneten Bauprodukten. Schließlich wird eine Bewertung der Wiederverwendung hinsichtlich Kosten, Ausbeute und Qualität der Endprodukte vorgenommen. Das zu entwickelnde Verfahren soll insbesondere auf kleine und mittlere Unternehmen mit handwerklicher Struktur ausgerichtet sein. Ein (digitales) Praxishandbuch soll das erarbeitete Wissen wiedergeben und mithilfe der Transferkanäle der Hochschule kostenfrei zur Verfügung gestellt werden.
Mittelgeber:
Baden-Württemberg Stiftung gGmbH
Laufzeit:
Februar 2024 - Januar 2027
Projektverantwortung:
Prof. Dr. Sebastian Hein (Hochschule für Forstwirtschaft Rottenburg)
Projektpartner:
Universität Tübingen
Stadt Hechingen
Projektmitarbeiter/innen:
Prof. Dr. Sebastian Hein
Dr. Armin Niessner
Stefan Ehekircher
Beschreibung:
Das, von der Baden-Württemberg Stiftung gGmbH geförderte, Forschungsvorhaben beschäftigt sich mit der Frage der Zukunftsfähigkeit von Eichen und Buchen unter den prognostizierten Klimaveränderungen und der daraus resultierenden regionalen Anbauwürdigkeit im Wald der kommenden Jahrzehnte in Deutschland. Buchen und Eichen stellen bedeutende einheimische Laubbaumarten dar, deren Wachstum durch den Klimawandel vor erhebliche Herausforderungen gestellt wird. Insbesondere höhere Temperaturen und längere Trockenphasen werden erwartet, was in Abhängigkeit von der Bodenart zu zusätzlichen Schwierigkeiten führt. Die verschiedenen Bodenarten - von Sand über Schluff zu Ton - weisen Unterschiede in Eigenschaften wie Wasserdurchlässigkeit, Durchlüftung, Durchwurzelbarkeit, pflanzenverfügbares Wasser, Porenvolumen und Wasserhaltevermögen auf. Um den Wasserhaushalt und das Wachstum der Bäume zu beurteilen, werden Messungen des Stammradius und des Saftflusses durchgeführt. Durch die Analyse dieser Parameter lassen sich Rückschlüsse auf den Gesundheitszustand und die Anpassungsfähigkeit der Bäume ziehen. Während die meisten existierenden Forschungsarbeiten vorwiegend einzelne Parameter der Baumgesundheit untersuchen, stützt sich das Projekt auf einen integrierten Ansatz von Messanordnungen mehrerer Sphären (Vegetation, Boden, Klima) und der Betrachtung ihrer Wechselwirkungen auf ausgewählten Versuchsflächen bei Hechingen. Auf diese Weise sollen datengestützte Erkenntnisse zur Klima-Wuchssensitivität beider Baumarten in Bezug auf die vorherrschenden Standortbedingungen gewonnen und kombiniert werden. Die Verknüpfung ökophysiologischer Sensorik (zeitlich hoch aufgelöster Stammzuwachs und Xylemfluss) mit geländeklimatologischen Messungen (Luft- und Bodenwasserhaushalt) und bildgebender Fernerkundung (durch hyperspektrale luftgestützten Bildaufnahmen und Zeitreihen von Satellitendaten) entlang ausgewählter Standortgradienten erlaubt die Analyse der witterungs-, bodenfeuchte- und bodenartspezifischen Trockenstressanfälligkeit von Buchen und Eichen. Aus den dadurch gewonnenen Informationen können Rückschlüsse auf die Auswirkung extremer Trockenjahre und die Erholungsfähigkeit älterer Waldbestände dieser Baumarten in Abhängigkeit vom Standort gezogen werden. Die Erkenntnisse werden herangezogen, um das regionale Anbaurisiko unter dem prognostizierten Klimawandel abzuschätzen und um regionale Anbau- und Pflegeempfehlungen für den Wald der Region anzugeben, und so einen kosteneffektiveren und klima-resilienteren Waldbau zu ermöglichen.
The project addresses the question of future silviculture of oaks and beeches under the projected climate changes and the resulting regional suitability in the forests of Germany over the coming decades. Oaks and beeches are significant native deciduous tree species whose growth is being significantly challenged by climate change. Higher temperatures and longer with more frequent dry periods are particularly expected, which will lead to additional difficulties depending on the soil type. The different soil types - ranging from sand to silt and clay - exhibit differences in properties such as water permeability, aeration, root penetration, plant-available water, pore volume, and water retention capacity. To assess the water balance and the growth of the trees, measurements of stem radius and sap flow are conducted. By analyzing these parameters, conclusions can be drawn about the health and adaptability of the trees. While most existing research predominantly examines individual parameters of tree health, this project relies on an integrated approach of measurement arrangements from multiple spheres (vegetation, soil, climate) and considers their interactions on selected experimental plots near Hechingen. In this way, data-supported insights into the climate-growth sensitivity of both tree species concerning the prevailing site conditions are to be obtained and combined. The linkage of ecophysiological sensors (highly resolved temporal stem radial growth and xylem flow) with field-climatological measurements (air and soil water balance) and remote sensing imaging (through hyperspectral airborne images and time series of satellite data) along selected site gradients allows for the analysis of the weather-, soil moisture-, and soil type-specific drought stress susceptibility of oaks and beeches. From the information thus obtained, conclusions can be drawn about the impact of extreme drought years and the recovery capacity of older forest stands of these tree species depending on the site. The findings will be used to estimate risks of regional forestry under the projected climate change and to provide regional recommendations for forest management of the region, thus enabling more cost-effective and climate-resilient forestry.

Projektträger:
Holzbau-Offensive Baden-Württemberg
Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg
Laufzeit:
November 2021 bis Juni 2024
Projektverantwortung:
Prof. Dr. Michael Rumberg
Prof. Dipl.-Ing. Architekt Ludger Dederich
Projektmitarbeiter/innen:
Dipl.-Ing. (Architektur) Holger Wolpensinger
M.A. Architektur Katja Zagrodnik
Beschreibung:
Trotz steigender politischer Bemühungen den Holzbau zu fördern, um dem Klimawandel entgegenzuwirken, stellt Holz als Baumaterial bei Nichtwohngebäuden immer noch eine Ausnahme dar. Es gibt auch kritische Stimmen, die die Nachhaltigkeit von Holzgebäuden anzweifeln. Bei Bauvorhaben der öffentlichen Hand sind die Entscheidungsträger in Politik und Verwaltung daher immer wieder mit der Schwierigkeit konfrontiert, fachlich und wissenschaftlich gut begründete Argumente für und gegen den Holzbau vorzulegen, um Projekte in ihrer Kommune zu initiieren.
Das Forschungsvorhaben stellt sich daher der Frage, wie Holzgebäude im direkten Vergleich mit mineralischen Bauten im ökobilanziellen Vergleich abschneiden und welche Argumente Entscheidungsträgern mitgegeben werden können.
Für belastbare Ergebnisse wird dieser ökobilanzielle Vergleich anhand von fünf Gebäuden durchgeführt, die von Seiten der öffentlichen Hand bereits errichtet worden sind. Dabei werden Gebäude, die aus Holz gebaut wurden, mit Gebäuden aus mineralischen Baustoffen verglichen. Eine der beiden Varianten wird zu diesem Zweck in Form eines virtuellen Gebäudes abgebildet. Somit ist insgesamt das Ziel, zehn Basis-Ökobilanzen für Gebäude der öffentlichen Hand zu erstellen. Dabei werden vor allem Nichtwohngebäude, wie zum Beispiel Verwaltungsgebäude, Schulen, Bibliotheken oder Kindergärten ins Auge gefasst. Darüber hinaus sollen relevante Optionen zur Optimierung der Ökobilanz von Gebäuden herausgearbeitet und weitere Varianten berechnet werden.

Mittelgeber/Projektträger:
Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg (MLR)
Laufzeit:
01.01.2024 bis 30.09.2024
Projektverantwortung:
Prof. Dr. Bertil Burian / Prof. Dr. Dr. h.c. Bastian Kaiser
Projektmitarbeiter/innen:
Dipl. Ing. Forst (FH) Annette Müller-Birkenmeier
M. Sc. Margarethe Hergott
Beschreibung:
Das Projekt setzt auf dem Ideenaufruf „Holzbau als Bestandteil des kommunalen Klimaschutzes“ auf, in dem 18 Kommunen bei der Entwicklung und Umsetzung neuer Wege zu mehr Holzbau in der Kommune gefördert werden. Um die in den Projekten gesammelten positiven Erfahrungen und Ansätze zur Förderung des klimafreundlichen Bauens mit Holz auf kommunaler Ebene einer möglichst großen Allgemeinheit bekannt zu machen, soll der Wissens- und Erkenntnistransfer zwischen den 18 geförderten Kommunen systematisiert, die gewonnenen Erkenntnisse miteinander abgeglichen und so aufbereitet werden, dass sie auf andere Vorhaben übertragbar sind. Schließlich sollen geeignete Formate identifiziert werden, mit denen die allgemein wertvollen Erkenntnisse einer wachsenden Anwendungs-Community zugänglich gemacht werden können.
Download:

PROJEKTTRÄGER/ MITTELGEBER:
Gefördert wird das Vorhaben durch das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) und die Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V. (FNR).
LAUFZEIT:
01.11.2023 bis 31.11.2025
PROJEKTVERANTWORTUNG:
Prof. Dipl.-Ing. (FH) Ludger Dederich
Hochschule für Forstwirtschaft Rottenburg
PROJEKTPARTNER:
Prof. Dr.-Ing. Björn Kampmeier
Hochschule Magdeburg-Stendal
Prof. Dr.-Ing. Jochen Zehfuß
Technische Universität Braunschweig
Institut für Baustoffe, Massivbau und Brandschutz
PROJEKTMITARBEITER/IN:
M.Sc. Robert Westphal Hochschule Magdeburg- Stendal
B.Sc. Kathrin Zipperle Hochschule Rottenburg
BESCHREIBUNG:
Aufgrund des großen Bedarfs an bezahlbarem Wohnraum sind insbesondere die innerstädtischen Ballungsräume auf Maßnahmen der Nachverdichtung angewiesen. In den hochverdichteten Bereichen wird durch die Schließung von Baulücken und die Bebauung rückwärtiger Grundstücke auf die Effekte der Urbanisierung reagiert. Weitere bauliche Möglichkeiten sind der nachträgliche Dachgeschossausbau und die Aufstockung von Bestandsbauten. Hierbei bietet sich die Holzbauweise aufgrund ihres günstigen Verhältnisses aus Masse zu Tragfähigkeit, den Wärmedämmeigenschaften und kurzen Bauzeiten an. Ein Hindernis der beschriebenen Nachverdichtung ist jedoch häufig die Lösung der Rettungswegsituation.
Durch die Belegung öffentlicher Straßen kann es in einer ohnehin dicht bebauten Innenstadt zu einer erheblichen Verschlechterung der Bedingungen zur Sicherstellung des zweiten Rettungsweges über das Gerät der Feuerwehr kommen. Diese Variante fällt ebenfalls bei erreichen der Hochhausgrenze von 22 m Gebäudehöhe weg.
Um eine sichere Rettung zu gewährleisten, soll innerhalb des Forschungsvorhabens untersucht werden, mit welchen Maßnahmen ein Treppenraum als einziger Rettungsweg ertüchtigt werden muss, ohne auf die vollständige Ausbildung eines Sicherheitstreppenraums nach MHHR angewiesen zu sein. Außerdem sollen der zweite bauliche Rettungsweg, sowie der Sicherheitstreppenraum für Hochhäuser, mit den bereits vorhandenen Vorschlägen aus Berlin und Hamburg für einen „Sicherheitstreppenraum light“ als möglicher Lösungsvorschläge überprüft werden.
Dabei sollen Rettungsweglösungen unter Berücksichtigung realistischerer Brandszenarien entwickelt werden, mit denen eine sichere und wirtschaftliche Ausführung von Rettungswegen in mehrgeschossigen Wohngebäuden ermöglicht wird, ohne das bauordnungsrechtliche Sicherheitsniveau abzusenken. Zum anderen sollen Lösungen für die Optionen innerstädtischer Nachverdichtung durch Aufstockungen erarbeitet werden. Im Rahmen des geplanten Forschungsvorhabens werden daher für typische Wohnungsgrundrisse und –konfigurationen, sowie veränderliche Brandlasten und Ventilationsverhältnisse, die Brandverläufe untersucht. Die Untersuchungen erfolgen zunächst numerisch und anschließend experimentell.
Auch wenn in den letzten Jahren eine Trendwende bei Bauaufsichtsbehörden und Feuerwehren erkennbar ist, wird die Sicherheit des mehrgeschossigen Holzbaus in Bezug auf die brandschutztechnischen Aspekte immer noch kritisch hinterfragt. Aus diesem Grund wird innerhalb des Forschungsprojekts Wert auf einen engen Informationsaustausch gelegt, um eine frühzeitige Akzeptanz der Forschungsergebnisse zu gewährleisten.

Mittelgeber/Projektträger:
Gefördert wird das Vorhaben durch das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) und die Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V. (FNR).
Laufzeit:
01.07.2023 bis 30.04.2024
Projektverantwortung:
Prof. Dipl.-Ing. (FH) Architekt AKNW Ludger Dederich
Projektpartner:
Das Projekt wird vom Institut für nachhaltiges Ressourcenmanagement (INR), vertreten durch FDIR. Dipl.-Forstwirt Norbert Wagemann, unterstützt.
Projektmitarbeiter/innen:
M.Sc. Melissa Christ
Beschreibung:
Bereits am 01.07.2023 startete das Projekt SeeRoMa „Seegras als Rohstoff – Machbarkeitsstudie“ unter der Leitung von Prof. Dipl.-Ing. Ludger Dederich. Das übergeordnete Ziel dieses Forschungsprojektes besteht darin, Treibsel, das ohne primären Verwendungszweck als natürlicher, pflanzlicher Abfall an den Küsten von Nord- und Ostsee anfällt, in Produktionsprozesse einzubringen und eine Vermarktbarkeit zu generieren. Um dieses Aufkommen nutzbar zu machen, muss dafür ein Markt gefunden werden, damit die auf Seegras basierenden Produkte als Alternative zu konventionellen Produkten eingesetzt werden können.
Vorrangiges Ziel ist es, eine Entscheidungsgrundlage für Marktakteure zu erarbeiten, die detailliert beschreibt, welche Rahmenbedingungen gegeben sein müssen, um Seegras als Rohstoff durch Weiterverarbeitung einer Wertschöpfungskette hinzuführen zu können. In einem Folgeprojekt wird das zentrale Thema die detaillierte Entwicklung von Prozessen und Techniken für die Aufnahme am Strand, die Aufbereitung sowie die Herstellung von konkreten Seegrasprodukten sein.
Die Machbarkeitsstudie umfasst auf der Bereitstellungsseite vor allem eine detaillierte Untersuchung des Aufkommens von Seegras entlang der Küsten von Nord- und Ostsee, einen generischen Vertragsentwurf zur geregelten Bereitstellung des Seegrases durch Kommunen sowie eine Kostenaufstellung für die einzelnen Parteien entlang der Wertschöpfungskette. Für die Absatzseite werden der Mengenbedarf zur Markteinführung sowie die technischen Ansprüche von Abnehmern untersucht, um die regionalen Verwertungschancen evaluieren zu können.
Das primäre Ziel besteht darin, Seegras als geregeltes Bauprodukt für das Bauwesen anzubieten. Dazu sollen Unternehmenspartner für den Herstellungsprozess und die Markteinführung der Seegrasprodukte sowie kommunale Partner für die Bereitstellung des Rohstoffes gewonnen werden.

“Woodcutter” or “climate saver” - self-image and future role concept of forestry students
Projektträger:
FNR
Laufzeit:
Oktober 2022 – April 2024
Projektverantwortung:
Prof. Dr. Stefanie Steinebach
Projektpartner:
FVA – Baden-Württemberg
Projektmitarbeiter/innen:
Leonard Sauter, B.Sc.
Beschreibung:
Die aktuellen ökologischen und gesellschaftlichen Veränderungen stellen eine große Herausforderung für die Forstwirtschaft der Zukunft dar. Die gesellschaftliche Rolle der Wälder mit Ökosystem- und Gemeinwohlleistungen gewinnt zunehmend an Bedeutung gegenüber der Holzproduktion, der bisherigen Kernaufgabe im Selbstverständnis von Forstleuten.
Diesen Veränderungen müssen sich auch die Studierenden der Forstwirtschaft an deutschen Hochschulen stellen. Das Projekt „Holzknecht oder Klimaretter“ geht deshalb der Frage nach, inwieweit angehende Förster:innen in ihrem Studium auf die erweiterten und sich wandelnden Anforderungen vorbereitet werden und wie die Studierenden diesen Wandel erleben. Konkret fragen wir danach, wie im Studium das Rollenverständnis als Förster:in entsteht, wie sich waldbezogene Wertehaltungen formen und wie mit Wissensbeständen angrenzender Disziplinen umgegangen wird.
Die aus dieser Forschung gewonnenen Erkenntnisse können dazu beitragen, Ansatzpunkte in der forstlichen Ausbildung zu identifizieren, die Wertehaltungen und das Selbstbild beeinflussen. Dadurch kann eine Auseinandersetzung von Studierenden und Lehrenden der Forstwirtschaft mit sich ändernden waldbezogenen Werten und Rollenbildern angestoßen werden. Durch die Vermittlung angepasster und zeitgemäßer Werte in der Ausbildung kann ein Wertewandel und eine Aktualisierung des Rollenverständnisses forstlicher Tätigkeiten auch innerhalb forstlicher Organisationen angestoßen werden.
Ongoing ecological and societal changes confront forestry with increasing challenges. Forests should contribute to public welfare (e.g. human recreation and health issues) and provide ecosystem services (e.g. mitigate climate change and secure biodiversity) rather than only provide wood. In contrast the task of wood production has been paramount in the self-understanding of German foresters over centuries.
In practice, the gap between societal demands on the forest and the self-understanding of foresters leads to increasing conflict in the goals and strategies of forest management.
In this study we aim to investigate the self-image and role concept of forestry students and how they might conflict with future tasks of foresters. Our hypothesis is, that self-images and role concepts of future foresters are largely formed and consolidated during university education. We investigate what kind of forest related values exist among forestry students at the beginning of their studies and if and how these are transformed during the course of the study. As forest related values are inseparably related to the self-image and role concepts of forester, this study can contribute to detect how self-images and role concepts of foresters are constituted during forestry education as so called “second socialization”. The results of this study can help to adjust forest curricula the way it contributes to self-images of future foresters that is in line with future tasks to meet societal demands on forests.
Weitere Informationen:
Downloads:

Teilprojekt B10: Light a limiting resource for diurnal butterflies in forests
Projektträger:
Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)
Laufzeit:
01.05.2022 - 31.03.2025 (35 Monate)
Projektverantwortung:
Prof. Dr. Thomas Gottschalk
Projektpartner:
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
Projektmitarbeiter/innen:
M.Sc. Simon Heitzler
Beschreibung:
ConFoBi ist ein von der DFG gefördertes Graduiertenkolleg (GRK) an der Universität Freiburg mit dem Ziel wissenschaftlichen Nachwuchs durch ein strukturiertes Promotionsprogramm für Führungspositionen innerhalb und außerhalb der Wissenschaft zu qualifizieren. Hierbei erforscht das Graduiertenkolleg wie wirksam strukturerhaltende Maßnahmen wie die Anreicherung von Habitatbäumen und Totholz für den Erhalt der Biodiversität in Wirtschaftswäldern sind, und wie Biodiversitätsschutz effektiv in andere Waldfunktionen integriert werden kann. Dabei wird eine Vielzahl von Taxa und Strukturelementen in insgesamt 16 Projekten im Schwarzwald untersucht. Eines dieser Projekte, das Projekt B10 „Light - a limiting resource for diurnal butterflies in forests” (Licht - eine limitierende Ressource für Tagfalter der Wälder) ist an der HFR angesiedelt und beschäftigt sich mit Tagfaltern und ihrer Abhängigkeit von Licht in Wäldern.
ConFoBi is a DFG-funded research training group (GRK) at the University of Freiburg with the aim of qualifying young scientists for leading positions within and outside of science through a structured doctoral program. In this context, the Research Training Group investigates how effective structure-preserving measures such as the enrichment of habitat trees and deadwood are for the conservation of biodiversity in commercial forests, and how biodiversity conservation can be effectively integrated into other forest functions. A wide range of taxa and structural elements are being studied in 16 projects in the Black Forest. One of these projects, the project B10 "Light - a limiting resource for diurnal butterflies in forests" is located at the HFR and deals with diurnal butterflies and their dependence on light in forests.
Link:
Download:

Projektträger:
Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e. V. (FNR)
Laufzeit:
01.09.2022 – 31.08.2024
Projektverantwortung:
Prof. Dr. Thorsten Beimgraben
Prof. Dr. Christoph Schurr
Projektpartner:
Fachhochschule Erfurt
re:member – Wandel mitgestalten
Projektmitarbeiter/innen:
M.Sc. Sebastian Rappold
B.A. / B.Sc. Luisa Kurzenhäuser
Beschreibung:
Das angewandte Forschungsprojekt „DIALOG – Zwischen Vorurteilen und Kooperation - Neue Ansätze zur Kommunikation im Waldumbau“ wird als Kooperationsprojekt zwischen der Hochschule für Forstwirtschaft in Rottenburg (Projektleitung), der Fachhochschule Erfurt sowie dem Unternehmen re:member – Wandel mitgestalten aus Potsdam durchgeführt. Es wird vom Förderprogramm nachwachsende Rohstoffe vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) gefördert. Die Projektlaufzeit beträgt zwei Jahre.
Das Forschungsvorhaben wurde unter dem Druck der Trockenjahre 2018, 2019 und 2020 und den damit verbundenen starken Waldschäden entwickelt. Aufgrund von Dürre und Borkenkäferkalamitäten infolge des Klimawandels sind ca. 160,5 Millionen m3 Kalamitätsholz auf einer Fläche von etwa 245.000 ha angefallen. Der Begriff des Waldsterbens 2.0 ist seither immer wieder zu vernehmen. Da der Klimawandel immer weiter fortschreitet, besteht dringender Handlungsbedarf. Da die Entscheidungen in der Forstwirtschaft nicht nur für wenige Jahre Gültigkeit haben, sondern mitunter für hunderte von Jahren gefällt werden, soll ein intensiver Blick auf die nachrückenden Generationen von Waldbewirtschaftern und Jägern geworfen werden. Hier besteht mit einer Anzahl von aktuell 385.000 Jägern und ca. zwei Millionen Waldbesitzern ein enormes Potential, um die gegenwärtigen und zukünftigen Herausforderungen zu meistern.
Zwischen diesen beiden Gruppen bestehen allerdings seit langer Zeit Konflikte. Die Akteure vertreten oft feste, manchmal sogar gegensätzliche Standpunkte und sind selten bereit, sich auf Kompromisse einzulassen. Waldbewirtschafter wollen Wildschäden durch Abschüsse von Schalenwild reduzieren, um strukturreiche und klimaangepasste Mischwälder aufzubauen. Jäger hingegen sehen sich als „Anwälte des Wildes“. Darüber hinaus werden die Ansprüche der Gesellschaft an das Ökosystem Wald stets größer und es kommt zu konkurrierenden Zielsetzungen. Auf der einen Seite steht der Waldbau. Dieser kollidiert oftmals mit dem Streben nach größerer Biodiversität sowie der energetischen Nutzung durch Holz bzw. Windkraft. Weiterhin bestehen Spannungen in Hinblick auf die Erholungsleistung des Waldes und die Wildbewirtschaftung. Da es sich bei Wald um ein Multi-Stakeholder-Umfeld handelt, wird es schwierig werden, gemeinsame Lösungsansätze zu finden. Solche sind bisher kaum zu erkennen. Aufgrund des zeitlichen Handlungsdruckes werden Kompromisse unumgänglich sein. Es gilt daher zu verhindern, dass einzelne Akteure ausschließlich eigene Interessen verfolgen. Die zukünftigen Aufgaben können nur durch gemeinschaftliches Handeln gelöst werden.
Die Untersuchungen werden anhand von Interviews und diversen Fragestellungen in sozialen Medien durchgeführt. Die schwerpunktmäßige Analyse erfolgt beim Schalenwildmanagement in Bezug zur Anpassung der Wälder an den Klimawandel. Dabei werden sechs Bundesländer vom Südwesten Deutschlands bis in den Nordosten betrachtet. Es handelt sich um die Länder Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Hessen, Thüringen, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern. Die Fragestellungen richten sich direkt an die Jäger und Waldbewirtschafter.
Das Projekt hat sich zum Ziel gesetzt, Wissen praxisnah zu generieren und anzuwenden. Die Leistungsfähigkeit von jungen Waldbewirtschaftern und Jägern soll durch die Stärkung und den Aufbau von gegenseitigen Beziehungen gesteigert werden. Hierdurch wird eine Verbesserung der waldbaulichen Situation angestrebt. In diesem Zusammenhang soll erforscht werden, welche Erwartungen aktuell an den Wald bestehen und mit welchen Erwartungen zukünftig zu rechnen ist. Weiterhin werden mögliche vorhandene Vorurteile sowie Kooperationsmöglichkeiten der Akteure herausgearbeitet. Als Ergebnisse sind ein Handlungsleitfaden „Kommunikation in Waldumbauprojekten“ sowie ein Schulungskonzept „Strategische Kommunikation für forstliche Akteure“ vorgesehen.
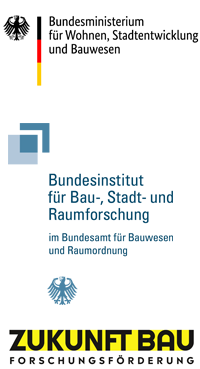
Projektträger:
Dieses Projekt wurde gefördert durch das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung im Auftrag des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen aus Mitteln der Zukunft Bau Forschungsförderung.
Laufzeit:
01.09.2022 bis 01.08.2025
Projektverantwortung:
Prof. Dr. Marcus Müller
Projektmitarbeiter/innen:
B.Sc. Christina Zwanger
Beschreibung:
Jedes Jahr fallen in deutschen Städten und Gemeinden große Mengen an Laub an. Dieses gesammelte Laub wird bisher kaum einer höherwertigen stofflichen Nutzung zugeführt. Meist wird es bisher entweder kompostiert oder thermisch verwertet.
Im Projekt soll zunächst ein geeigneter Aufbereitungsprozess entwickelt werden, um Laub, das von den Gemeinden gesammelt wird, weiter zu einem Einblasdämmstoff zu verarbeiten. Dazu gehört unter anderem die Trocknung, Reinigung von Fremdstoffen und Zerkleinerung. Grundlegende Eigenschaften des Materials wie beispielsweise der Schwermetallgehalt, das Feuchteaufnahme und –abgabeverhalten sollen dabei untersucht werden. Je nach Ergebnis der Voruntersuchungen wird das zerkleinerte Laub zusätzlich mit verschiedenen Additiven behandelt, um die Anforderungen, welche an Einblasdämmstoffe gestellt werden, zu erfüllen. Wichtige Eigenschaften, die in diesem Zuge geprüft werden, sind unter anderem: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedurchlasswiderstand, Setzmaß und die Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl.
Aufbauend auf die Entwicklung des Einblasdämmstoffes soll geprüft werden, ob sich das Material zu einem Plattendämmstoff weiterverarbeiten lässt. Unter Zugabe von geeigneten Bindemitteln und Additiven wird eine Rezeptur zur Herstellung von Dämmstoffplatten entwickelt. Diese werden dann auf alle für Dämmstoffplatten relevanten Eigenschaften hin untersucht.
Ein weiterer Bestandteil des Projekts wird die Untersuchung der potentiellen Ressourcen und Verfügbarkeit von Laub sein, um die Möglichkeit einer späteren industriellen Nutzung einschätzen zu können. Abschließend wird die Ökobilanz des neuen Dämmstoffs untersucht.


Projektträger:
Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e. V. (FNR)
Laufzeit:
01.09.2022 – 31.08.2025
Projektverantwortung:
Prof. Dr. Monika Bachinger
Projektpartner:
Hochschule der Medien Stuttgart (HDM)
Bodensee-Stiftung
Projektmitarbeiter/innen:
M.A. Franziska Schlemmer
Beschreibung:
Die Erholung in Wäldern ist als Common Pool Ressource (CPR) mit den Problematiken der Übernutzung und der Nutzungskonflikte konfrontiert. Die Forschung zu CPRs zeigt, dass erfolgreiche Lösungen auf kollektiver Verantwortungsübernahme, Selbstverpflichtung und Gruppenbeziehungen basieren, die selbst wiederum Ergebnis deliberativer Kommunikationsprozesse sind. Das vorliegende Projekt stellt deliberative Kommunikation zwischen den Akteurinnen und Akteuren im Konfliktfeld „Erholungsnutzung Waldes“ in den Mittelpunkt. Das Projekt leistet über einen Mix an quantitativen sowie qualitativen Methoden a) die Identifikation von Konflikttypen, b) die Analyse der biophysischen, sozioökonomischen und institutionellen Voraussetzungen dieser Konflikte, c) die Identifikation der kommunikativen „Konfliktarena“ im Sinne von konfliktbezogenen Diskursen, und d) die Identifikation von Ansprüchen und Wertehaltungen von Erholungsnutzenden im Wald sowie von Konfliktwahrnehmung und bisherigen Lösungsansätzen. Auf Basis dieser Informationen wird das Projekt über vier Kommunikationskampagnen e) deliberative Kommunikationslösungen entwickeln und die Akteurinnen und Akteure im Konfliktfeld „Erholungsnutzung Wald“ befähigen, deliberative Kommunikationsprozesse zu initiieren und durchzuhalten. Alle Arbeitsschritte dieses Projektes werden medial begleitet. Das Projekt erreicht auf diese Weise bereits während der Laufzeit gesellschaftliche Wirkung über die multimediale Einbindung der Öffentlichkeit, fachlicher Akteure und Studierender. Eine Kurzbeschreibung zum Projekt können Sie auch hier herunterladen | PDF.
Download:

Projektträger:
Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg
Laufzeit:
11/2021 bis 10/2023
Projektverantwortung:
Prof. Dr. Thorsten Beimgraben
Projektmitarbeiter/innen:
Luisa Kurzenhäuser
Beschreibung:
Bei Ausbruch eines Tierseuchenereignisses ändern sich die jagdlichen Rahmenbedingungen für die am Jagdbetrieb Beteiligten grundsätzlich. Je nach Lage des Reviers innerhalb des Seuchengebiets können für Jagdpächter einschneidende und zeitaufwendige Maßnahmen in Kraft treten, die nicht jeder Pächter erfüllen kann oder möchte. Sichere und konstante Organisationsformen bei Seuchenausbruch, aber auch schon im Vorfeld des Seuchenauftritts, sind jedoch ein wesentlicher Aspekt bei der erfolgreichen Prävention und Bekämpfung. Deshalb soll untersucht werden, inwieweit und in welchen Fällen die Bejagung in Eigenregie als Organisationsmodell eine sinnvolle Alternative zur Verpachtung eines Jagdbogens darstellen kann. Dabei sollen insbesondere folgende Punkte bearbeitet werden:
- Bestimmung von Anzahl und räumlicher Verteilung bestehender Regiejagdbetriebe in Baden-Württemberg
- Gründungsumstände, -vorgänge und -widerstände
- Betriebswirtschaftliche Betrachtungen zu Zielsetzungen, Wirtschaftlichkeit und Wildschadensregelungen
- Untersuchung von üblichen, aber auch besonderen Organisationsstrukturen
- Identifizierung von Best-Practice Beispielen, innerhalb und außerhalb Baden-Württembergs
- Befragung von Schlüssel-Akteuren, insbesondere Flächeneigentümern, Jagdorganisatoren und Jagenden
Aus den Ergebnissen sollen Empfehlungen für den erfolgreichen Aufbau und Betrieb von Regiejagdmodellen abgeleitet werden, sowohl allgemein, als auch im speziellen Fall eines Seuchenausbruchs.
Projektträger:
Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg - Sonderprogramm zur Stärkung der biologischen Vielfalt
Laufzeit:
01.07.2022 – 31.08.2025
Projektverantwortung:
Prof. Dr. Thomas Gottschalk
Projektpartner:
ForstBW, Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
Projektmitarbeiter/innen:
M.Sc. Heiko Hinneberg
Beschreibung:
Die Mehrzahl der auf lichte Waldlebensräume spezialisierten Tier- und Pflanzenarten sind stark rückläufig und in ihrem Bestand gefährdet. Tagfalter sind in besonderem Maß von diesem Rückgang betroffen. Neben dem Fehlen von Großherbivoren und der gestiegenen atmosphärischen Stickstoffdeposition ist eine veränderte Waldbewirtschaftung für die Bestandsrückgänge verantwortlich. Durch die flächige Bewirtschaftung als Dauerwald ist das Lückensystem des Waldes für den Erhalt überlebensfähiger Schmetterlingspopulationen heute vielerorts unzureichend. Eine letzte Bastion für seltene Lichtwaldschmetterlinge ist die Schwäbische Alb. Dort sollen - basierend auf wissenschaftlichen Erkenntnissen aus dem Forschungsprojekt „Nachhaltige Waldwirtschaft zur Förderung von Lichtwaldarten unter besonderer Berücksichtigung des Blauschwarzen Eisvogels“ - Maßnahmen zur Förderung von Lichtwaldarten umgesetzt und evaluiert werden. Die Maßnahmen umfassen motormanuelle Auflichtungen an Waldrändern, entlang von Wegböschungen und an Sonderstandorten. In ausgewählten Beständen kommen auch Kleinkahlhiebe auf rotierenden Flächen als Instrument zur Habitatschaffung zum Einsatz. Das Projektgebiet umfasst die Landkreise Alb-Donau, Esslingen, Göppingen, Heidenheim und Reutlingen. Die Maßnahmenumsetzung wird durch Informationsangebote für die Öffentlichkeit begleitet, die Erfahrungen aus dem Projekt münden in einen Leitfaden zur Herstellung und Pflege lichter Waldbiotope.
Download:


Respect for the last remaining European virgin forests
Projektträger:
Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) & Heidehofstiftung
Laufzeit:
2021 - 2024
Projektverantwortung:
Prof. Dr. Rainer Luick
Projektpartner:
EURONATURE Foundation
Projektmitarbeiter/innen:
Matthias Schickhofer & Ion Holban
Beschreibung:
In Deutschland gibt es schon lange keinen Urwald mehr und selbst alte und sehr naturnahe Wälder haben nur einen kleinen Anteil an unseren Waldflächen. Insgesamt haben kaum noch 2% der europäischen Wälder (ohne Russland) Urwaldcharakter. Bezogen auf die EU liegen sicher 70% in den rumänischen Karpaten. Das sind zwischen 100 000 und 150 000 Hektar, eine genaue Inventur gibt es nicht.
Bei (Ur)Waldzerstörung denken wir oft an die Tropenwälder im Amazonasgebiet oder auf Borneo. Im Falle von Rumänien ist es im Grunde vor unserer Haustür. In Rumänien gibt es selbst in Schutzgebieten, wie in Nationalparken, großflächige legale und illegale Holzeinschläge. Seit dem EU Beitritt Rumäniens 2007 sind mindestens 100 000 Hektar Urwälder und sicher mehr als 200.000 Hektar sehr naturnahe Wälder, meist im großflächigem Kahlhieb, abgetrieben worden.
Die Urwälder und die alten naturnahen Wälder in den Karpaten sollten, nein müssen, uns auch in Deutschland interessieren, denn große Mengen des billigen Holzes oder den daraus hergestellten Produkten aus Urwäldern und sehr alten Wäldern landen auch auf den deutschen Märkten. Auch wir in Deutschland haben somit eine Verpflichtung, Verantwortung für den Schutz dieses wichtigen europäischen Naturerbes zu übernehmen. Zwar gibt es auch in Rumänien (in Theorie) Normen für den Schutz dieser Wälder, doch mangelt es an Umsetzung, Kontrolle und an Sanktionen. Dazu zählt auch die Verweigerung, die Erstellung eines vom Parlament schon vor Jahren beschlossenen Nationalen Katalogs als nationale Aufgabe zu sehen.
Die Hochschule für Forstwirtschaft Rottenburg plant, aufbauend auf den Erfahrungen eines Vorgängerprojektes (mit Förderung der DBU) und in Kooperation mit weiteren Partnern, das Engagement zum Schutz der letzten großflächigen europäischen Urwälder fortzusetzen. Damit kann ein weiterer wichtiger Beitrag zur Sicherung von unersetzlichem europäischem Naturerbe geleistet werden. Das Projekt soll auch Motivation sein, Impulse auslösen und Best-practise Empfehlungen bereitstellen für notwendiges Engagement von anderen Akteuren. Im Detail sind folgende Teil-Vorhaben geplant:
- Identifizierung und Kartierung ökologisch und wissenschaftlich besonders wichtiger Urwaldgebiete als Vorschläge zur Aufnahme in den Nationalen Katalog der Urwälder und Quasi-Urwälder für Rumänien.
- Organisation und Durchführung eines Methodenworkshops zur Vermittlung von Know-how zur Kartierung und zum Monitoring von (Ur)Waldrefugien für forstlich / ökologisch kompetente rumänische WissenschaftlerInnen.
- Entwicklung von Wertschöpfungs-Konzeptionen und Initiierung von Prozessen in ländlichen Regionen / Kommunen mit großen Urwaldanteilen. Ziel ist, Bewusstsein zu vermitteln und Optionen aufzeigen, wie Urwälder und sehr naturnahe Wälder auch durch „forstliches Nichtstun“ wirtschaftlich interessant sein können.
Downloads:
Weiterführende Informationen:
- https://www.hs-rottenburg.net/aktuelles/aktuelle-meldungen/meldungen/aktuell/das-narrativ-von-der-klimaneutralitaet-der-ressource-holz/
- https://www.hs-rottenburg.net/aktuelles/aktuelle-meldungen/meldungen/aktuell/2021/die-letzten-urwaelder-in-mitteleuropa/
- https://www.deutschlandfunk.de/kahlschlag-im-urwald-rumaenien-und-die-holzmafia-dlf-c8084474-100.html
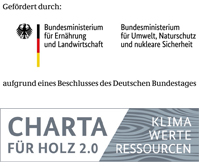
Laufzeit:
01.09.2021 – 31.08.2024
Projektträger:
Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V. / Waldklimafonds
https://www.waldklimafonds.de/
Teilvorhaben 2 : Ökophysiologie und Stressanfälligkeit der Douglasie entlang eines ozeanisch-kontinentalen Klimagradienten in Deutschland ("Doug-Goes-Risk")
Projektleiter des Teilvorhabens 2:
Prof. Dr. Sebastian Hein
Projektmitarbeiter:
Dr. Viviana Horna (horna@hs-rottenburg.de)
Göran Spangenberg
Kooperationspartner und Leiter des Verbundvorhabens:
Dr. Alexander Land
Universität Hohenheim, Institut für Biologie (190a)
AG Dendroklimatologie
Beschreibung:
Die bereits heute alarmierenden Auswirkungen des Klimawandels auf unsere Wälder erfordern auf den verschiedensten Ebenen waldbauliche Maßnahmen um die Widerstandsfähigkeit und Toleranz der Wälder gegenüber Trockenstress zu erhöhen. Eine Möglichkeit ist hierbei die vermehrte Verwendung nicht einheimischer Arten, welche von Natur aus an trockene Bedingungen angepasst sind. Von besonderem Interesse ist dabei die Douglasie (Pseudotsuga menziesii [Mirb.] Franco), die im Westen der USA heimisch ist und dort auch Phasen mit Sommertrockenheit toleriert. Da sie sehr wuchsstark ist, wird sie seit langem in Deutschland angebaut und bedeckt nach Angaben des Bundesministerium für Ernährung bereits heute ca. 2% des deutschen Waldes.
Für den Anbau der Douglasie in Europa fehlen jedoch noch belastbare ökophysiologisch und somit kausal belegte Informationen über deren Toleranz gegenüber saisonaler Trockenheit. Das Forschungsvorhaben „Doug-Goes-Risk“ soll diese Kenntnislücke schliessen.
Ziel des Projektes ist die Bestimmung der witterungs- und bodenfeuchtespezifischen Trockenstressanfälligkeit der Douglasie und deren Auswirkung auf den saisonalen Stammzuwachs und Wasserhaushalts im ozeanisch-kontinentalen Klimagradienten in Deutschland. Dabei sollen konkrete Grenzwerte der der tolerierten Feuchteverhältnisse und Temperatur für Wachstumsinduktion- und Hemmung sowie Frost- und Trockenstress ermittelt werden.
Hierzu werden an vier Standorten entlang eines Klimagradienten in Deutschland an jeweils zehn Douglasien der Stammwasserfluss, die Stammradialveränderung und die Kambialtemperatur kontinuierlich erfasst. Gleichzeitig werden die Bodenfeuchten in zwei Tiefen und das Standortklima gemessen. Die synoptische Analyse der physiologischen und klimatischen Parameter erlaubt dann die Abschätzung der Trockenheitssensitivität der Douglasie.
Projektstand:
Gegenwärtig läuft die Installation und der Test der Messensorik an den ausgewählten Standorten in Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg (Rammert), Bayern und Brandenburg. Der Messbeginn ist für März 2022 vorgesehen.

Ca. einhundertjährige Douglasie am Standort in Nordbayern (Limmersdorfer Forst) mit automatischem Radial-Dendrometer und Kambialtemperatursensor (links am Stamm) sowie einem Datenlogger (rechts).
Links:
- https://www.fnr.de/projektfoerderung/projektdatenbank-der-fnr/projektverzeichnis-details?fkz=2219WK37B4&cHash=1fe4663c646f6ef9049c0a5421f9cea7
- https://www.uni-hohenheim.de/themenservice-artikel?tx_ttnews[tt_news]=52861
English:
The already alarming effects of climate change on our forests require silvicultural measures at multiple levels in order to increase the resilience and tolerance of forests to drought stress. One possibility is the intensified use of non-native species that are naturally adapted to dry conditions. Of particular interest is Douglas-fir (Pseudotsuga menziesii [Mirb.] Franco), a native tree species from western North America that tolerates periods of summer drought in that region. Douglas fir has long been cultivated in Germany because it is very fast growth. According to the German Federal Ministry of Food and Agriculture, Douglas fir already covers about 2% of the German forests.
For the cultivation of Douglas fir in Europe, however, there is still a lack of reliable ecophysiological and thus substantiated causal information on its tolerance to seasonal drought. The research project "Doug-Goes-Risk" aims to fill this knowledge gap.
The objectives of this projec are:
- to determine the weather- and soil moisture-specific drought stress susceptibility of Douglas-fir and the effect on seasonal stem growth and water balance along an oceanic-continental climate gradient in Germany, and
- to identify concrete threshold values of tolerated humidity and temperature conditions for growth induction and inhibition.
For this purpose, stem water flow, stem radial change and cambial temperature will be continuously recorded at four locations along a climatic gradient in Germany on ten Douglas fir trees. At the same time, soil water content at two depths and site climate will be measured. The synoptic analysis of the physiological and climatic parameters allows the estimation of the drought sensitivity of Douglas fir.
TheForestCleanup: Entwicklung innovativer Wuchshüllen aus NaWaRo & Konzepte zur Vermeidung von Plastikakkumulation im Wald mehrweniger
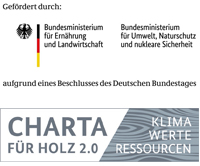
TheForestCleanup: Development of innovative treeshelters made of renewable resources & concepts to avoid plastic accumulation in the forest
Projektträger:
Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V. / Waldklimafonds https://www.waldklimafonds.de/
Laufzeit:
01.03.2020 – 28.02.2023
Projektverantwortung:
Prof. Dr. Sebastian Hein (Leitung des Gesamtvorhabens) und Prof. Dr. Michael Rumberg
Projektpartner:
Tecnaro, Gesellschaft zur industriellen Anwendung Nachwachsender Rohstoffe mbH/ www.tecnaro.de
Sachsenröder GmbH & Co. KG/ www.sachsenroeder.com
Schoeller Technocell GmbH & Co. KG/ www.felix-schoeller.com
Hohenstein Institut für Textilinnovation gGmbH/ www.hohenstein.de
Assoziierter Partner:
Innonet Kunststoff TZ Horb GmbH & Co. KG/ www.innonet-kunststoff.de/
Projektmitarbeiter/innen:
Yannic Graf
Projektkoordination
graf@hs-rottenburg.de
Dr. Silke Feifel
Ökobilanzierung
feifel@hs-rottenburg.de
Anton Schnabl
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
schnabl@hs-rottenburg.de
Beschreibung:
Plastikprodukte stehen als in der Umwelt meist persistente Partikel in öffentlicher Kritik. Wuchshüllen und Wuchsgitter (Abk. WH, meist aus PE, PP, HDPE, PVC) spielen dabei mit Neuausbringung im zweistelligen Millionenbereich in der Waldbewirtschaftung in Deutschland eine sehr bedeutsame Rolle, sowie durch ein Vielfaches an nicht wieder eingesammelten WH. Dabei lassen die Verwendung seltener Baumarten im Klimawandel, der Waldumbau in stabile Mischbestände und die kostengünstige Wiederbewaldung nach klimabedingten Sturmereignissen, stark steigende Einsatzzahlen erwarten. Das Vorhaben [TheForestCleanup] zielt daher auf den strategischen Auf- und Rückbau von WH: Im strategischen Aufbau werden innovative WH entwickelt mit den Eigenschaften: (1) hergestellt aus nachwachsenden (Holz-)Rohstoffen (Substitution), (2) unter Labor- und Waldbedingungen zertifiziert und vollständig biologisch abbaubar, (3) mindestens funktionsgleich zu bisherigen WH und (4) in der Ökobilanz besser. Basierend auf Vorstudien von Werkstoffproben, werden in einer Produktchallenge Compounds für Unternehmen zur Extrusion und Konfektionierung von Prototypen zu Verfügung gestellt. Versuchsanordnungen im Labor und Wald an ausgewählten Orten Deutschlands, Erfahrungen aus Aufbau, Monitoring, statistischer und ökobilanzieller Analyse, fließen in das Reengineering zur Optimierung von Werkstoffen und Prototypen ein bis zu einem Produkt unmittelbar vor Serienreife. Im strategischen Rückbau werden technische und sozioökonomische Konzepte entwickelt, zum Umgang mit nicht entfernten Plastik-WH. Die Rahmenbedingungen von WH werden in bundesweiter Betrachtung des Systems Waldwirtschaft-Mensch analysiert: bzgl. Bilanzierung von Verwendungszahlen, Entsorgung und Kosten, Kundenpräferenzen, öffentliche & forstbetrieblich-interne Kommunikationskonzepte, Recht, forstlicher Förderpraxis und Beschaffungswesen. Die Integration von forstlichen Stakeholdern sichert einen erfolgreichen Innovationsprozess und ermöglicht Umsatz und Beschäftigung.
English:
Plastic products are under criticism for producing persistent particles in the environment. In forest estates throughout Germany tree shelters (abbr. TS, mostly made of PE, PP, HDPE, PVC) are amounting to a two-digit Million of newly installed items/y. Such plastic products play a significant role as many are not collected but often remain in the forest. In the future the use of tree species that are more resistant to the climate change however being rare and thus highly susceptible to browsing, the conversion of pure, even-aged into mixed and stable forests as well as low-cost reforestation after large-scale storm events will lead to an even higher need for TS in forestry. The project [TheForestCleanup] thus aims at both (A) constructing new and (B) removing of old TS from the forest. Requirements to innovative TS are: (1) made of renewable resources, (2) certified and fully biodegradable proven by test in labs and under real forest conditions, (3) at least as functional as classical TS and (4) finally with a better LCA compared to TS to date on the market. (A) A product challenge is organised where companies for extrusion and assembling of prototypes can apply. Laboratory tests, experimental plots on selected forest sites across Germany as well as advanced statistical analysis and finally LCA in feedback to the construction process will optimise a product immediately before series readiness. (B) Removal of old plastic TS will include setting up technical and socio-economic concepts followed by their implementation in forest estates. The framing conditions of TS are analysed at the whole country level considering the forest-people system comprehensively: drawing up a balance sheet (including disposal), costs, customer preferences, public & forestry-internal communication, legal aspects, government funding and rules for public procurement. Finally integrating forest stakeholders will ensure a successful innovation and improve turnover and employment in the forest-bioeconomy sector.



