Aktuelle Projekte im Forschungsschwerpunkt Biomasse - Logistik und Konversion

Mittelgeber/Projektträger:
Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, Vermögen und Bau Baden-Württemberg über Projektträger Zukunft – Umwelt – Gesellschaft (ZUG) gGmbH
Laufzeit:
01.11.2022 – 31.03.2025
Projektverantwortung:
Prof. Dr. Brunotte
Projektmitarbeiter/innen:
B.Sc. Nicole Veith
Beschreibung:
Die Hochschule Rottenburg (HFR) strebt danach, die Klimaneutralität (=Netto-Treibhausgasneutralität) zu erreichen. Im Zuge dieses ambitionierten Vorhabens wird ein ganzheitliches Klimaschutzkonzept für die Hochschule entwickelt. Diese Initiative wird im Rahmen der nationalen Klimaschutzinitiative vorangetrieben, die von der Bundesregierung ins Leben gerufen wurde, um Projekte zu unterstützen, die einen bedeutenden und nachhaltigen Beitrag zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen leisten.
Das Klimaschutzkonzept erfordert eine multidisziplinäre Herangehensweise sowie die Erarbeitung von evidenzbasierten Strategien, um die Netto-Treibhausgasneutralität zu erreichen. Dazu zählen die Identifizierung und Quantifizierung der Treibhausgasemissionen, ihre Reduzierung durch gezielte Maßnahmen an der Hochschule unter Berücksichtigung sozialwissenschaftlicher Aspekte wie die Akzeptanz von Klimaschutzmaßnahmen sowie die Auswahl geeigneter Technologien zur Deckung des Eigenbedarfs. Das Konzept basiert auf fundierten wissenschaftlichen Erkenntnissen im Bereich erneuerbarer Energien sowie Energie- und Materialeffizienz. Es umfasst die Erstellung verschiedener Szenarien mit einem umfassenden Maßnahmenkatalog, die Festlegung von klaren Zielen, die Entwicklung einer Strategie zur langfristigen Umsetzung und Kommunikation, Potenzialanalysen sowie die Ausarbeitung einer nachhaltigen Strategie.

Mittelgeber/Projektträger:
Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD)
Laufzeit:
01.01.2023-31.12.2024
Projektverantwortung:
Prof. Dr. Stefan Pelz
Projektpartner:
Universidade Estadual do Centro-Oeste, UNICENTRO – Campus de Irati
Beschreibung:
Brasilien birgt ein erhebliches Potenzial für holzige Biomasse. Bekannt sind vor allem Kiefer- und Eukalyptusplantagen, die in erster Linie Holz für die Papier- und Zellstoffindustrie und die Sägeindustrie liefern. Die weitaus größere Quelle für den Rohstoff Holz erstreckt sich jedoch in Form des sekundären Naturwalds Wald Floresta Ombrófila Mista (FOM) auf rund 1,8 Millionen Hektar in den südlichen Bundesstaaten Brasiliens. Seit 2001 gelten in dieser Waldform rechtliche Beschränkungen für gefährdete Arten des FOM-Waldes, die schließlich zu einem Bewirtschaftungsverbot führten. Dies begünstigt allerdings die Ausbreitung invasiver Baumarten wie Hovenia dulcis Thunb., insbesondere in stark anthropogen beeinflussten Gebieten, wodurch der ursprüngliche Charakter des Waldes mehr und mehr verloren geht.
Das Projekt ProCaria, mit den Partneruniversitäten UNICENTRO aus Iratí und Universidade Federal in Curitiba strebt Lösungen für diese Situation an. Hauptziel von ProCaria ist die Entwicklung, Bewertung und langfristige Einführung von Biomassebereitstellungs- und Wertschöpfungsketten im Rahmen des Austauschs von Studierenden und Forschenden (Master of Science, PhD, PostDoc). Diese Initiativen tragen zur nachhaltigen Bewirtschaftung von FOM für die Bioökonomie bei, mit Fokus auf Einkommen aus nachhaltiger Bewirtschaftung und Biomassenutzung. Geplante Produktlinien umfassen Bioenergie, innovative Holzprodukte und fortschrittliche Biokohle, auch für die stoffliche Nutzung. Das vom DAAD unterstützte Projekt ermöglicht den internationalen Austausch von jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, einschließlich brasilianischer ForscherInnen, die an der HFR zwischen 6 und 9 monatige Forschungsaufenthalte verbringen.
Mittelgeber/Projektträger:
Geldspenden
Laufzeit:
01.10.2022 – 31.08.2024
Projektverantwortung:
Prof. Dr.-Ing. Harald Thorwarth
Projektpartner:
Biomasse Heizkraftwerk Herbrechtingen GmbH, Fernwärme Ulm GmbH, SchwörerHaus KG
Projektmitarbeiter/innen:
M. Sc. Johanna Eichermüller
Beschreibung:
Aschen aus der Holzverbrennung und dabei insbesondere Flugaschen enthalten hohe Gehalte an umweltkritischen Metallen. Diese stellen deshalb einen Stoff dar, der aktuell aufwändig, in dafür geeigneten Deponien, meist untertage entsorgt werden muss. Dabei stellen diese Aschen einen Wertstoff dar, welcher nicht deponiert, sondern in Sinne des Kreislaufgedankens genutzt werden sollte. Denn Aschen enthalten Phosphor und andere für das Pflanzenwachstum relevante Elemente wie Kalium, Natrium, Schwefel, etc. Daneben werden die umweltkritischen Metalle und dazu zählen auch die Platingruppenmetalle Indium, Kobalt und Seltenerdmetalle, für Hightech- und Umwelttechnologien benötigt.
Ziel
Das Vorhaben zielt auf die Entwicklung eines Verfahrens zur Aufbereitung von Holzaschen, um diese als Rohstoff für eine biobasierte Kreislaufwirtschaft zu erschließen. Um die Asche im Sinn einer konsequenten Kreislaufführung vom Schadstoff zum Wertstoff zu transformieren wird ein Verfahren benötigt welches Spurenelemente aus Aschen abtrennt. Damit soll die Asche in eine Düngemittelfraktion und eine Schwermetallfraktion aufgetrennt werden. Die Düngemittelfraktion soll dann direkt oder nach weiterer Aufbereitung als Substitut für künstliche Dünger zur Verfügung stehen. Die Schwermetallfraktion soll metallurgischen Prozessen zugeführt werden können und damit knappe Rohstoffe, welche nach Deutschland importiert werden müssen, substituieren. Im Ergebnis sollen damit im Sinne eines Urban-Mining Ansatzes Deponien sowie Primärrohstoffe geschont werden.

Long-term monitoring and functionality of particulate matter separators for individual room heating appliances in the field.
Mittelgeber/ Projektträger:
Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL)/Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe (FNR)
Laufzeit:
01.01.2023 – 31.12.2025
Projektverantwortung:
Prof. Dr. Stefan Pelz
Projektpartner:
Technologie- und Förderzentrum (TFZ), Deutsches Biomasseforschungszentrum (DBFZ), Kutzner + Weber GmbH, OekoSolve AG, Exodraft A/S
Projektmitarbeiter/innen:
M.Sc. Julian Drewes
M.Sc. Florian Empl
Beschreibung:
Im Vorhaben „LangEFeld“ wird erstmals in Europa ein Langzeit-Monitoring von Elektroabscheidern im Feld an Einzelraumfeuerungsanlagen wie Pellet- und Kaminöfen durchgeführt. Hierbei sollen die Wirksamkeit, Verfügbarkeit und mögliche Alterungseffekte der Elektroabscheider, v.a. die Abscheideeffizienz im Echtbetrieb untersucht werden. Ein wichtiger Aspekt ist die Prüfung und Entwicklung von geeigneten Messverfahren zur Ermittlung des Abscheidegrads und zur Bestimmung der Partikelanzahl und Partikelgrößenverteilung. Daraus werden Empfehlungen an die Praxis hinsichtlich der Betriebssicherheit und der Vermeidung von Fehlbedienungen formuliert. Gleichzeitig werden Grundlagen erarbeitet, um zukünftig effektive Staubminderungsmaßnahmen zu entwickeln sowie wirkungsvolle Benutzerregeln und angepasste Fördermaßnahmen für die nachrüstbaren Komponenten zu etablieren. Das Projekt nutzt die gewonnenen Erkenntnisse und Prüfstände an den drei beteiligten Institutionen auch, um die erheblichen Wissenslücken in der Langzeitwirkung von Katalysatoren zu schließen, die ebenfalls als ein vielversprechendes Instrument zur Reduktion der organischen Emissionen aus Holzfeuerungen gelten.
In the "LangEFeld" project, long-term monitoring of electrostatic precipitators in the field is being carried out for the first time in Europe on single room combustion systems such as pellet and wood stoves. The aim is to investigate the effectiveness, availability and possible ageing effects of the electrostatic precipitators, especially the separation efficiency in real operation. An important aspect is the testing and development of suitable measurement methods to determine the capture efficiency and to determine the particle number and particle size distribution. From this, recommendations will be formulated for practical application with regard to operational safety and the avoidance of operating errors. At the same time, basic principles are being worked out in order to develop effective dust reduction measures in the future and to establish effective user rules and adapted conveying measures for the retrofittable components. The project is also using the knowledge gained and the test benches of the three participating institutions to close the considerable gaps in knowledge about the long-term effectiveness of catalytic converters, which are also considered a promising instrument for reducing organic emissions from wood combustion devices.
Links:
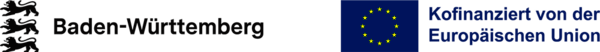
Mittelgeber/Projektträger:
Europäische Union – Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE)
Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg
Laufzeit:
03.03.2022 – 28.02.2027
Projektverantwortung:
Prof. Dr.-Ing. Harald Thorwarth
Projektpartner:
FairEnergie GmbH
FairNetz GmbH
Hochschule Reutlingen / Reutlingen University
Stadtwerke Mössingen
Stadtwerke Rottenburg am Neckar GmbH
Stadtwerke Tübingen GmbH
Sülzle Holding GmbH & Co. KG
Technische Hochschule Ulm
Projektmitarbeiter/innen:
B.Sc. Svenja Ott
Beschreibung:
Das Leuchtturmprojekt H2-Grid erprobt dezentrale Konzepte und weist deren Funktion durch vernetzte Demonstratorsysteme in der Modellregion für eine ökologisch und ökonomisch effiziente Integration von Elektrolyseuren in Haushalte, Industriebetriebe (KMUs), Quartiere und Kommunen in einem Konzept nach.
In diesem Konzept wird der erzeugte Wasserstoff an Abnehmer (Wasserstoffzug, Wasserstofftankstellen, ÖPNV, Industrie) in der Region abgegeben. Die beim Elektrolyseprozess entstehende Wärme wird über ein Wärmenetz genutzt, der entstehende Sauerstoff nach Bedarf einer direkten Nutzung zugeführt.
Der innovative Charakter des Projekts besteht in der optimierten Betriebsführung durch ein sektorübergreifendes, prognosebasiertes Demandmanagement, das die Verfügbarkeit von grünem Strom einerseits und die Wasserstoff- und Wärmebedarfe andererseits berücksichtigt und so zu einem ökonomisch und ökologisch optimierten Betrieb führt. Zusätzlich werden Aspekte wie die Netzdienlichkeit des Anlagenbetriebs berücksichtigt.
Das Engineering umfasst den Aufbau der Elektrolyseure, Fragen der Gasübergabe und -speicherung, die Sektorkopplung, eine prognose- und angebotsgesteuerte Regelung der Gesamtanlagen, die Teillastoptimierung der Elektrolyseure sowie die Erprobung von lokalen und netzübergreifenden Regelstrategien unter Einbeziehung des virtuellen Kraftwerks Neckar-Alb und der kommunalen Netzleitstellen.
Ziel:
Erprobung dezentraler netzdienlicher Konzepte zur Erzeugung von grünem Wasserstoff.

Projektträger:
Bundesministerium für Bildung und Forschung
Laufzeit:
29.07.22-28.07.25
Projektverantwortung:
- Prof. Dr. Stefan K. Pelz,
- Prof. Dr. Steffen Abele
Projektpartner:
- University of Energy and Natural Ressources (UENR) Sunyani, Ghana,
- Novis GmbH,
- Neyer Brainworks GmbH,
- AHT Syngas Gruppe
Projektmitarbeiter/innen:
- M.Sc. Ralf Mueller,
- M.Sc. Florian Empl
- Joseph Yankyera Kusi (Externer Doktorand, Gastwissenschaftler)
- M.Phil. Agricultural Economics Felix Kwame Ayenyebo
Beschreibung:
Das Ziel des Projekts „LevelUp“ ist die Erforschung der technischen und wirtschaftlichen Machbarkeit eines dezentralen Energiesystems basierend auf lokalen biogenen Reststoffen aus Agrar- und Forstwirtschaft für die zuverlässige und nachhaltige Versorgung mit Strom, Wärme, Kälte und Biogas in Westafrika, mit besonderem Fokus auf Ghana. Zu diesem Zweck wird gemeinsam mit den Partnerunternehmen eine Mehrkomponenten-Forschungsanlage auf dem Campus der University of Energy and Natural Ressources (UENR) in Sunyani, Ghana entwickelt und implementiert. Die Anlage besteht aus den Prozesskomponenten Biomasseaufbereitung (incl. solarthermische Trocknung), Biomassevergasung, Biomasse-fermentation und Kälteerzeugung (Absorptionskälteanlage). Das Gesamtziel des Verbundes ist die erfolgreiche Entwicklung und Installation, die spezifische Optimierung und umweltrelevante Einordnung des Systems, die Schulung von MitarbeiterInnen für die Inbetriebnahme und den Betrieb der Gesamtanlage sowie die zukünftige Vermarktung inklusive eines private-public-partnership Betreibermodells, das die Grundlage für einen Transfer des Energiesystems in die Breite darstellt.
The aim of the "LevelUp" project is to research the technical and economic feasibility of a decentralised energy system based on local biogenic residues from agriculture and forestry for the reliable and sustainable supply of electricity, heating, cooling and biogas in West Africa, with a special focus on Ghana. For this purpose, a multi-component research plant is being developed and implemented together with the partner companies on the campus of the University of Energy and Natural Resources (UENR) in Sunyani, Ghana. The plant consists of the process components biomass preparation (incl. solar thermal drying), biomass gasification, biomass fermentation and cooling (absorption chiller). The overall goal of the network is the successful development and installation, the specific optimisation and environmentally relevant classification of the system, the training of employees for the commissioning and operation of the entire plant as well as the future marketing including a private-public-partnership operator model, which represents the basis for a transfer of the energy system on a broad scale.